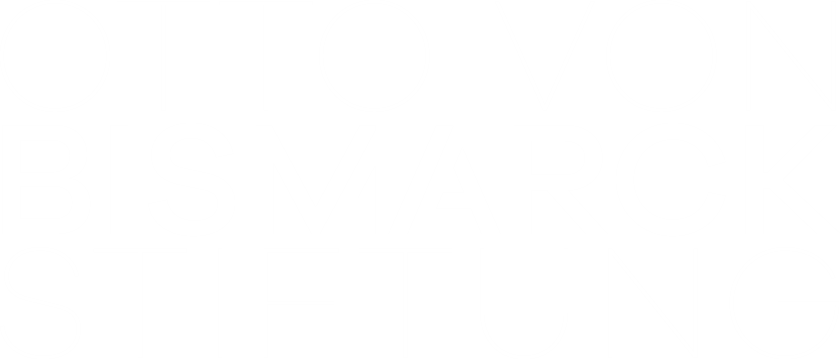Gespräch mit dem italienischen Ministerpräsidenten Francesco Crispi, Friedrichsruh
2. Oktober 1887
Bismarck betont seine Liebe zu „großen Bäume, das sind Ahnen“. Auf den Besitz des Sachsenwaldes lege er größeren Wert als auf seinen Fürstentitel. Von seinen Wohnsitzen sei Friedrichsruh für ihn der „bequemste“, weil er auf dem Lande leben und zugleich die Regierungsgeschäfte „in der Hand halten“ könne. „Wir sind nur vier Stunden vom Reichskanzleramt entfernt.“
„Nun, wie hat Ihnen Hamburg gefallen?“
„Ich habe wenig davon gesehen, Durchlaucht. Aber nach dem Eindruck, den ich empfangen habe, muß es eine große, schöne, wohlhabende und blühende Stadt sein.“
„Ihr Eindruck ist richtig. Hamburg ist nicht nur der erste Hafen Deutschlands, sondern der erste des Festlandes. Die Zukunft kann seinen Reichtum, der ohnehin schon fabelhaft ist, nur noch vermehren. Ich glaube sagen zu dürfen, daß ich dazu beigetragen habe, indem ich den Hamburgern entzog, was sie als unumgängliche Bedingung für den Reichtum ihrer Stadt betrachteten: nämlich die Zollfreiheit, die ihnen durch die Verträge von 1815 zugestanden und vom Reich provisorisch anerkannt worden war.“
„Ich habe eine unbestimmte Erinnerung, daß die Hamburger nicht ohne Widerspruch diese Wohltat von Eurer Durchlaucht empfangen haben.“
„In der Tat haben sie anfangs durch die Stimmen aller meiner Gegner sich gegen den Druck aufgelehnt, welchen ich gegen Hamburg und alle Hansestädte ausüben wollte; sie haben von allen Dächern geschrieen, daß ich ihren Ruin herbeiführen wolle, und einige von ihren Tagesblättern haben mich mit Beleidigungen überhäuft. Am liebsten hätten sie mich gehängt. Jetzt haben sie eingesehen, daß ich recht hatte. Weit entfernt, durch die Unterdrückung des Freihafens zu verlieren, haben sie dadurch gewonnen. Indem Hamburg dem deutschen Zollverein [Der Vertrag über den Anschluß der Stadt Hamburg an den Zollverein datiert vom 25. Mai 1881] beitrat, ist es in der Tat der Hafen für ganz Deutschland geworden. Der Import, der bereits beträchtlich war, hat sich gesteigert, und der Export schon verdreifacht. In sechs Jahren! [...] Jetzt erkennen die Hamburger die Wohltat an, die ich ihnen erwiesen; sie würden mir gerne Kränze flechten und mir zu Ehren Triumphbögen errichten. Ich hüte mich aber, trotz der wiederholten Einladungen der Mitglieder des Senates und der Vertretung der Bürgerschaft, ihnen zu willfahren und mich nach Hamburg zu begeben, aus Furcht vor den Huldigungen, die mich erwarten würden.“
„Und es gab eine Zeit, wo die Hamburger Eure Durchlaucht hängen wollten!“
„Ja, ohne viele Umstände, wenn sie gekonnt hätten.“ – Schweigen. – „Wenn man jedesmal gekonnt hätte, so oft man mit Ihnen derart vorgehen wollte, Durchlaucht . . .“
Der Fürst lachte und antwortete: „So hätte es nicht genug Stricke gegeben.“
Die Unterhaltung kehrt nun wieder zu den Hamburgern zurück, während Crispi fortfährt, die ihm überbrachten Briefe durchzusehen.
„Sie verdienen ihren Wohlstand; sie sind mutig, unternehmend, tätig, ausdauernd … Für sie ist nach Amerika gehen eine Spazierfahrt. Sie fahren hin und kehren von dort ebenso leicht zurück, wie Sie auf vierzehn Tage in der schönen Jahreszeit nach einer Ihrer Besitzungen gehen. So findet man denn auch in Hamburg mehr als irgendwo in Europa Erzeugnisse jeder Art aus Nord und Südamerika: Bananen, Ananas, seltene Vögel, Affen... ‚Draußen‘ sagen sie manchmal ganz kurz, ‚draußen‘, das ist für sie Amerika, da draußen.“
Man spricht wieder von Friedrichsruh. Es ist kein eigentliches Dorf da und zum Beispiel auch keine Kirche. Nur einige Häusergruppen und im Walde zwei kleine Weiler. Der Wald reicht, man kann wohl sagen bis ans Haus, über das einige Riefenbäume ihre Zweige ausbreiten. Die im Walde vorherrschende Gattung ist die Buche. Beim Hause indessen befinden sich Eichen und Tannen.
„Durchlaucht haben immer den Wald geliebt?“ „Immer; ich liebe die großen Bäume, das sind Ahnen ...“
Der Minister war inzwischen mit Lesen fertig geworden und nahm wieder an der Unterhaltung teil.
„Ihr Besitztum ist sehr groß!“ „Ja, es ist groß... Dreißigtausend Morgen Hochwald, das heißt ungefähr viertausend Hektar. Ich lege darauf größeren Wert als auf den Fürstentitel, den mir Seine Majestät gnädigst verliehen hat.“ „Das eine paßt gut zum anderen.“
„Und ich bin für beides Seiner Majestät sehr dankbar! Sie sehen das Haus, es war, wie ich Ihnen sagte, eine Herberge, ein Hotel, wenn Sie wollen. Ich ließ den Pachtvertrag erlöschen und nahm hier meinen Aufenthalt. Ich habe noch andere Wohnsitze, aber dieser ist für mich am bequemsten, um auf dem Lande zu bleiben und zugleich die Leitung der Geschäfte in der Hand zu behalten. Wir sind nur vier Stunden vom Reichskanzleramt entfernt. Sechzehn Bahnzüge verkehren täglich zwischen Berlin und Hamburg, darunter mehrere Schnellzüge. Ich bin also in fortwährendem Verkehr mit meinen Kanzleien, jeden Abend setzen sie mich bezüglich der Tagesgeschäfte aufs Laufende, und jeden Morgen schicke ich die Papiere zurück, die ich tags zuvor empfangen, die einen unterzeichnet, die anderen mit meinen Instruktionen. Mit einem Wort, die Arbeit wird erledigt, wie wenn ich mich in Berlin befände, ja vielleicht noch besser, denn die Post ist verläßlich und pünktlich. Auch in Ihren Kanzleien wird es oft vorkommen, daß ein Diener Papiere, die er besorgen und übergeben soll, auf irgendeinem Tisch im Vorzimmer herumliegen läßt; das kommt nicht vor, wenn der Kurier zur bestimmten Stunde abgehen muß.“
Man geht spazieren, macht bald Halt, bald setzt man sich wieder in Marsch. Der Fürst hat einen Stock in der Hand, auf den er sich manchmal stützt.
„Indem ich mich hier niederließ, habe ich mich einer Einnahme von fünfzehntausend Mark beraubt, das ist ein hübscher Pachtzins.“ „In der Tat,“ sagt der Minister, „das macht so viel wie bei uns die Besoldung eines bevollmächtigten Ministers und außerordentlichen Gesandten erster Klasse oder die des Präsidenten eines Kassationshofs.“
Man spricht vom Erträgnis der Grundstücke im allgemeinen und den Besoldungen in Preußen und in Italien; im Scherze erwähnt man das französische Sprichwort: „Für den König von Preußen arbeiten.“ Das Haus Savoyen, wie das Hohenzollernsche, hat sparsame Fürsten gehabt, die mit verschwenderischen und prachtliebenden Fürsten abwechselten. Bei dem Vergleich zwischen Preußen und Italien kam heraus, daß die beiden Staaten ihre Diener nicht sehr reichlich entlohnen, Italien aber die seinigen noch am schlechtesten bezahlt. Einer aus der Umgebung des Fürsten bemerkte: „Freilich, aber das Leben ist bei Ihnen im allgemeinen leichter, das gleicht die Sache aus.“
„Trotzdem,“ sagt der Minister, „kann kein Staatsdiener, der verheiratet ist und Familie hat, bei uns, ohne große Opfer zu bringen, von seiner Besoldung allein leben. Der Staatsdienst bringt keinen Reichtum und soll auch keinen bringen, aber er sollte zum Unterhalt derjenigen hinreichen, die sich ihm widmen. Bei uns richtet er manchmal seinen Mann zugrunde ... Man wird arm bei der Regierung. Ein Minister empfängt fünfundzwanzigtausend Franken jährlich, eine durchaus ungenügende Summe, wenn man seinem Range gemäß leben will... .“
Man erwähnt Massimo d’Azeglio, der nachdem er drei Jahre Premierminister gewesen, seine Pferde verkaufen und Bilder malen mußte, um zu leben. Seit seiner Zeit ist das Leben um mehr als die Hälfte teurer geworden.
Der Minister spricht von England, wo die hohen Besoldungen, die Apanagen, die Pensionen für die Familien fortbezahlt werden, bis herab zu den entfernten Nachkommen eines Staatsmannes, der dem Lande Dienste erwiesen habe.
Marlborough bekam sieben Millionen und den fürstlichen Besitz von Blenheim, Lady Canning eine Pension von dreitausend Pfund Sterling. Der englische Staatsschatz zahlt heute noch den Nachkommen des Siegers von Höchstädt und Malplaquet eine Jahrespension…
Die beiden Staatsmänner entfernen sich unter den Bäumen in der Richtung des Parks. Ihre Begleiter lassen sie einige Schritte vorausgehen, damit sie bequemer miteinander sprechen können.
Vom Hause her meldet man dem Fürsten, daß das Frühstück serviert sei. Seine Durchlaucht und der Minister kehren langsam, zusammen plaudernd, zurück. Die Fürstin ist im Salon.
Das Frühstück hält sich zwischen dem englischen Lunch und dem, was man in Frankreich im achtzehnten Jahrhundert „Ambigu“ nannte. Mehrere kalte Platten, Schinken, Geflügel, Butter und so weiter stehen auf dem Tisch. Es bedient sich wer will, und man reicht sich nachbarlich zu. Währenddem bieten die Diener warme Gerichte an, Eier, Kotelettes, Beefsteaks, Kartoffeln und so weiter.
„Wissen Sie, wie man das bei uns nennt?“ fragt der Fürst seinen Nachbar zur Linken, indem er auf prächtige, nach englischer Art gekochte Kartoffeln zeigt.
„Nun... Kartoffeln, Durchlaucht.”
Ja, aber man nennt sie auch pommerische Bananen. Diese Bezeichnung werden Sie wohl nicht kennen.“ „Nein, diese Bananen nähren schöne Grenadiere.“ „Das ist wahr . . . Sehen Sie diesen Schweninger, der trotzdem nicht will, daß ich welche essen soll. Ach, böser Doktor!“ „Sit modus in rebus!“ antwortete der Arzt.
Aus Höflichkeit hat man der Speisekarte ein italienisches Gericht eingefügt. Man reicht Makkaroni, und der Fürst nimmt sich, als die Reihe an ihn kommt, ziemlich viel. Der Minister drückt sein Erstaunen aus, daß Doktor Schweninger dem Fürsten italienische Mehlspeisen zu essen gestatte. „Die Aerzte,“ sagte er, „möchten sie auch mir, der ich sie immer gegessen habe, verbieten.“
„Wenn ich auf ihn hörte, würde Schweninger es mit mir machen, wie sein Kollege mit Sancho Pansa, dem Gouverneur der Insel Barataria ... er verbietet mir die Makkaroni, aber ich esse sie doch: er ist kurzsichtig.“
Aus Gewohnheit oder aus Dankbarkeit, als eine Art Mahnung oder als Erinnerung stehen gesalzene Häringe auf dem Tische, jene vielbesprochenen Häringe, die einige Wochen hindurch die einzige Nahrung des Fürsten bildeten. Es sind übrigens prächtige Exemplare ihrer Gattung. Seine Durchlaucht bietet seinen Gästen an und fordert auf, sie zu kosten. „Das ißt man nicht allein ... . Damit der Häring wahrhaft gut sei, muß man ihn mit Butter und pommerischen Bananen essen. Sie wissen nun, was das ist. Bedienen Sie sich, wenn Sie Lust haben.“ Seine Durchlaucht wendet ich an den Doktor: „Sie haben mich nicht gesund gemacht, Schweninger, täuschen Sie sich darüber nicht, die Häringe haben es getan.“
Der Fürst hat für seinen Arzt eine sichtliche Neigung. Eine große Familiarität herrscht zwischen ihnen, immer ehrfurchtsvoll und ergeben von seiten des Doktors, freundschaftlich und scherzhaft von seiten des Fürsten...
An Getränken haben die Gäste des Fürsten die Wahl zwischen Wein und Bier. Man serviert Bordeaux und Moselwein, beide in der entsprechenden Temperatur. Der Minister hält sich an gewöhnlichen Bordeaux, den der Fürst bescheiden nach englischer Art seinen „Claret“ nennt und der ein ausgezeichneter St. Julien ist. Wir machen dem Fürsten unsere Komplimente über die Vortrefflichkeit seiner Weine, die offenbar Sorten ersten Ranges sind. „Richten Sie Ihre Komplimente an meinen Sohn. Graf Herbert hat gegenwärtig die Leitung des Kellers. Ich muß sagen, daß er sich dieser Aufgabe trefflich entledigt.“
Man spricht von den italienischen Weinen, von ihren Mängeln, von den guten Eigenschaften, die sie besitzen, und von denjenigen, die sie gewinnen könnten, wenn die italienischen Produzenten die Geschicklichkeit und die Gerätschaften der französischen Produzenten hätten.
„Frankreich ist von euch abhängig, was die Weine zum Verschneiden betrifft.“ „Die Zeit wird kommen, wo wir selbst Bordeaux in Apulien machen werden...“ „Sie müssen Tischweine machen und anerkannte, dauernde Marken.“
Der Minister rühmt mit Recht den Wein von Syrakus und bittet die Fürstin um die Erlaubnis, ihr einige Kisten schicken zu dürfen. Er wendet sich an sie und nicht an den Fürsten, denn dieser zugleich starke und süße Wein ist eher ein Damenwein. Er spricht von den Reben, die er noch kürzlich auf seinen Besitzungen in Syrakus pflanzen ließ.
Der Fürst kennt Norditalien, das er mit Frau von Bismarck im Jahre 1847 auf der Hochzeitsreise besuchte. Er sah damals Mailand, Genua und Venedig, wo er sich zur gleichen Zeit befand wie König Friedrich Wilhelm IV.
Die künstlerische Seite unseres Landes scheint ihm keinen tiefen Eindruck hinterlassen zu haben. Da Seine Durchlaucht unsere Städte bei ihren italienischen Namen nennt — Venezia, Genova, Milano — so fragt ihn jemand, ob er als Polyglotte auch unsere Sprache kenne. „Un poco,“ antwortete er, „genug, um eine Zeitung zu lesen und zu verstehen. Ich kenne eine gewisse Zahl von Stammwörtern, aber ich vermag den Modus und die Suffixe nicht zu finden. So kenne ich das Zeitwort leggere, aber vielleicht könnte ich es nicht nach allen Zeiten und nach allen Personen konjugieren: io leggo, tu leggi...“
Der Fürst hat seine beiden Hunde, Tyras und Rebekka, bei sich. Von Zeit zu Zeit wirft er dem einen oder dem andern ein Stück Brot hin. Es kommt ein Augenblick, wo der Fürst mit der Hündin zu spielen beginnt und sie neckt, indem er ihr ein Stück Brot hinhält, das er wieder zurückzieht und tut, als ob er es hinwerfen wollte, und es in der Hand behält, um es von neuem zu zeigen und zurückzuziehen und so weiter.
Jemand machte die Bemerkung, daß man in der Politik manchmal dasselbe Spiel getrieben hat. Man könnte in der Geschichte manchen großen Staatsmann finden, der es mit einem Staate, den er ködern will, gerade so macht, wie der Kanzler mit seiner Hündin: das Stück Brot ist in diesem Falle eine Provinz oder ein Königreich. Dasjenige, dessen sich Napoleon I. bediente, war Hannover; aber der ehrliche Friedrich Wilhelm III. ließ sich durch solches Spiel nicht fangen. Man hat manchmal behauptet, daß Bismarck es 1865 mit Napoleon III. so gemacht habe, indem er sich Belgiens bediente. Aber diese Behauptung müßte erst noch bewiesen werden.
„Man hat mich auch verdächtigt,“ sagt der Fürst, „nach Holland Gelüste gehabt zu haben... Wir haben so schon genug Bevölkerungen unter einen Hut zu bringen.“ Der Fürst ist gewiß der wunderbarste Plauderer, den man sich vorstellen kann. Fürstin Melanie Metternich erklärte ihn 1851 „für sehr angenehm und außerordentlich geistreich“. Und Fürstin Melanie war nicht gerade wohlwollend in ihrem Urteil. Er plaudert gerne und liebt es, wenn man ihm zuhört. Er selbst hat im Ausstieg seiner einzigartigen Laufbahn Humboldt und den Fürsten Metternich für sich gewonnen, indem er ihnen zuhörte.
Graf Thun von Hohenstein, sein österreichischer Kollege am Bundestag zu Frankfurt, fragte ihn, als er von Johannisberg [Das Besitztum des ehemaligen Staatskanzlers Fürsten Metternich am Rhein] zurückkehrte, eines Tages:
„Ich weiß nicht, was Sie dem alten Fürsten angetan haben. Sie beherrschen ihn.“
Bismarck antwortete: „Ich erkläre es Ihnen mit zwei Worten: ich höre ihm aufmerksam zu.“
Dem Fürsten Bismarck zuzuhören ist ein unaussprechliches Vergnügen. Alles, was er sagt, hat Wert oder gewinnt Wert, indem es über seine Lippen kommt. Er ist ein geborener Künstler; er hat die erforderliche Biegsamkeit der Stimme und den richtigen Blick, das plötzliche Innehalten, das ausgedachte Stocken, die nötigen Pausen, die Gebärde zur nachdrücklichen Betonung, das bedeutungsvolle Schweigen.
Fürst und Fürstin beschäftigen sich sehr viel mit dem Minister und find voll Zuvorkommenheit gegen ihn. Crispi seinerseits ist ausgezeichneter Laune und zeigt sich gegen seine Hauswirte so bezwingend liebenswürdig, wie er es sein kann, wenn er will. Die Gabe zu bezaubern ist etwas Seltenes. Es hat sie nicht jeder, der will. Aber man kann Jagen, daß diese Gabe der Vorzug vieler Staatsmänner war.
Die Tischgenossen wundern sich über die Mäßigkeit Crispis. In der Tat, wenn der Italiener anerkanntermaßen mäßig ist, so ist Crispi noch ein Mäßiger unter den Mäßigen. Er ißt wenig und trinkt noch weniger — eine einzige Sorte Wein, und niemals ungemischt.
„Waren Sie auch schon so mäßig als Sie jung waren?“ fragte der Fürst. „Ich war immer derselbe!“ Zum Nachtisch kamen prachtvolle Früchte: Birnen, Aepfel, erstaunlich große, schöne und wohlschmeckende Trauben. Wir haben in Italien ähnliche Früchte selten gesehen. „Das ist,“ sagte der Fürst, „ein Geschenk aus Rheinpreußen.“
Der Fürst hat zahlreiche bekannte und unbekannte Bewunderer, die sich ein Vergnügen und eine Ehre daraus machen, ihm die schönsten ihrer Erzeugnisse zu verehren. „Man bekommt viele Geschenke in meiner Stellung, und zwar durchaus uneigennützige. Man muß sie annehmen. Was soll man tun? Man kann sie nicht ablehnen, das würde die Leute verstimmen und beleidigen.“
Beim Kaffee behauptet Dr. Schweninger, der vielleicht zu Paradoxen aufgelegt ist, daß ein Mann von guter Gesundheit zwölf kleine Gläschen Kognak im Tag trinken müsse. Wahrscheinlich ändert sich die Zahl nah dem Breitegrad und dem Klima. Er entwickelt seine These mit Geist.
Der Fürst bittet den Arzt um die Erlaubnis, „ein Gläschen Kognak zu Ehren des „Signore Crispi“ trinken zu dürfen. Doktor Schweninger zögert oder stellt sich, als ob er zögere.
„So ist es immer! Er will mir meine Einfälle nicht hingehen lassen, wenn es sich um Dinge handelt, die er gerne hat. Er hat Angst, daß ihm nicht genug bleibt... Beruhigen Sie sich, mein Lieber, was den Kognak anbelangt. Es bleibt für Sie noch übrig, auch wenn Sie mich trinken lassen. Ich habe noch vierhundert Flaschen von derselben Sorte und vom selben Jahrgang ... und er ist sehr alt.“
Man geht in den Salon. Graf Herbert bietet Zigarren, der Fürst Feuer an... Vormittags raucht der Fürst nicht.
Ein Gemälde zieht unsere Blicke auf sich: Der Vorwurf ist ein Angriff deutscher Reiterei auf eine Abteilung französischen Fußvolks, der Kampf von Mars-la-Tour …
Graf Herbert erzählt einzelnes darüber und erweist der Tapferkeit der Franzosen Gerechtigkeit. Aber er tadelt ihr Schießen, das mörderischer hätte sein können. „Das hindert nicht, daß zwei Tage nachher auf den Gefilden von Mars-la-Tour alles noch blau und weiß von toten Kürassieren und Dragonern war.“
Während Seine Durchlaucht spricht, nähert sich ihm die Fürstin, richtet ihm die Rockklappe, welche sich ein wenig umgedreht hat, und zieht die Krawatte, die sich etwas verschoben hatte, an ihren Platz zurück. Der Fürst trägt noch die langen Binden von weißem Musselin oder schwarzer Seide, die sich mehrmals um den Hals legen lassen. „Seit fünfzig Jahren,“ sagt er lachend, „liege ich im Kampfe gegen meine Krawatte. Der Knoten will niemals an seinem Platz bleiben . . . und zwar dreht er sich immer nach derselben Seite. Da man sich von allem Rechenschaft ablegen muß, erkläre ich diese Erscheinung durch eine Bewegung des Kopfes, die bei mir häufiger in einer Richtung als nach der andern geht, und durch die Einwirkung meiner Barthaare, die, scharf rasiert, bürstenartig wirken. In der Tat ist mir ähnliches nicht vorgekommen, als ich einen Vollbart trug.“ Auch der Minister trug früher einen Vollbart, was ihm, trotz der starken Verschiedenheit ihrer Züge, eine Ähnlichkeit mit Mazzini gab. „Ich trug einen Vollbart in den ersten Zeiten meiner Mission in Frankfurt. Ich trug ihn auch während und nach meiner großen Krankheit. Meine Frau liebte es nicht. Sie bestand darauf, daß ich mich rasiere. Ich habe nachgegeben... und doch ist es so bequem gewesen!“
Die Fürstin fällt ein: „Es war vielleicht bequem, aber es stand dir sehr schlecht. Es war abscheulich.“ „Abscheulich oder nicht,“ schloß der Fürst, „Sie hätten es ebenso gemacht wie ich: ich habe diesen Schmuck auf dem Altar des häuslichen Friedens geopfert.“
Der Minister spricht mit dem Grafen Herbert von Bismarck, und beide sitzen abseits. Einer von uns plaudert mit dem Fürsten, der ihm liebenswürdig Aufmerksamkeit schenkt.
„Jetzt, da ich die Ehre habe, mich in der Nähe Eurer Durchlaucht zu befinden und Sie von Angesicht zu Angesicht zu sehen, scheint es mir, daß keines der Bildnisse, die Ihre Physiognomie so populär gemacht haben, wirklich ähnlich sei... Niemals, soviel ich weiß, hat man Sie zum Beispiel mit dem Ausdruck gezeigt, den Ihre Züge im Familienleben, in der Vertraulichkeit des home haben. Ich sehe Sie jetzt mit dem Ausdruck von Güte, den ich noh nicht an Ihnen kannte. Ich möchte, wenn Euer Durchlaucht erlaubt, beifügen, daß man im allgemeinen auch darauf kaum gefaßt ist. Und doch muß das im täglichen Leben Ihr gewöhnlicher Ausdruck sein.“ Der Fürst hört lächelnd zu; sein Lächeln ist nachsichtsvoll und gutmütig…
Die Fürstin näherte sich und hörte die letzten Worte. „Sie haben recht, mein Mann ist wirklich gut.“
Der Fürst lächelte, vielleicht ein wenig spöttisch. Er scheint sagen zu wollen: „Man sollte sich nicht zu sehr darauf verlassen.“ Er bemerkt aber nur: „Das ist nicht jedermanns Ansicht.“ Dann, auf die Frage der Bilder zurückkommend: „Gewiß ist, daß mir die Photographien gewöhnlich keinen sehr liebenswürdigen Ausdruck geben . . . das muß von den Apparaten herkommen.“
Seine Durchlaucht spricht nun von den Malern, denen er gesessen und die von ihm berühmt gewordene, tausendmal durch die Photographie reproduzierte Bildnisse gemacht haben: von Werner, von Lenbach …. Ein Bildnis von Lenbach, das in Friedrichsruh angefertigt wurde, stellt den Fürsten en face dar, in bürgerlicher Kleidung mit der nämlichen geschlossenen Juppe, die wir an ihm sehen, der nämlichen Halsbinde und dem nämlichen breitrandigen Schlapphut. Die Augen schauen gerade vor sich hin ins Weite mit einem gedankenvollen, etwas traurigen Ausdruck. Der Fürst scheint sich mit seinem Denken in ferne Visionen verloren zu haben. Ein anderes Bildnis, gleichfalls von Lenbach, stellt ihn im Dreiviertelsprofil, barhäuptig, in einer gleichfalls nachdenklichen Haltung dar. Werner hat den Staatsmann und Redner, Lenbach den Denker wiedergegeben.
„Ich habe da noch ein anderes Porträt von mir, von einem Amerikaner, der allerdings weniger berühmt ist als Werner und Lenbach. Haben Sie es gesehen?“ Der Fürst führt uns in einen anderen Salon. Ein großes Bildnis nimmt die Mitte einer der Wände ein. Ist es wirklich der Fürst? Ein General in sitzender Stellung in kleiner Uniform an einem Tische, im Dreiviertelprofil, dick und aufgeschwollen . . . Nein, das ist er nicht.
Die Fürstin bittet den Minister, einige Worte in ein Album zu schreiben, das sie ihm darreicht und das er eröffnen soll. Sie läßt ihn auch eine Photographie des Fürsten aussuchen, auf die Bismarck seine Unterschrift sehen soll. Der Minister hat einige Worte in das Album der Fürstin geschrieben – einige Worte, die eine Anspielung auf die patriotischen Gesinnungen des Fürsten und den Ausdruck des Wunsches nach Frieden enthalten, der sie beide beseelt. Die Fürstin liest sie mit lauter Stimme und dankt. Langsam und ernst sagt der Fürst, indem er die Worte, wie um ihre ganze Bedeutung zu betonen, scharf akzentuiert: „Euer Exzellenz haben meine Gedanken gut ausgelegt. Ich arbeite für die Aufrechterhaltung des Friedens. Ich lebe nur dafür... Wir haben genug durch den Krieg ausgerichtet. Laßt uns jetzt durch den Frieden und für den Frieden arbeiten und in Uebereinstimmung miteinander handeln.“ Schwer, den Eindruck wiederzugeben, den auf uns diese wenigen Worte machten, mit der Ruhe der Ueberzeugung von dem Manne gesprochen, der tatsächlich die Geschicke des deutschen Volkes lenkt und von dem zu einem so großen Teil das Los Europas abhängt.
Der Graf de Launay wird aus Berlin erwartet und von Graf Herbert am Bahnhof abgeholt.
Fürst und Fürstin scheinen bemüht, ihre Freundschaft für de Launay recht zu zeigen. „Er ist einer der Unsrigen, fast schon ein Berliner,“ sagte die Fürstin. ….
„Gegen zwei Uhr ziehen sich der Fürst, der Minister und der Botschafter zurück. Der Fürst verläßt bald seine beiden Gäste, um ein wenig auszuruhen.
Gegen drei Uhr vereinigte man sich zu einem Spaziergang in den Wald. Wegen der Unsicherheit des Wetters geben wir es im letzten Augenblick auf, zu Pferde zu steigen. Der Fürst mit dem Minister, Graf Herbert mit dem Grafen Launay fahren in zwei offenen Kaleschen davon, bei denen man das Dach herunterlassen kann, wenn der Regen stärker wird. Im Augenblick des Einsteigens bemerkt der Fürst, daß der Minister nur einen leichten Ueberzieher umgenommen hatte. „Exzellenz, Sie werden sich erkälten. Erlauben Sie mir, Ihnen diesen Militärmantel zu leihen, er wird Sie warm halten. Ich kann davon erzählen, ich bediente mich seiner im Feldzug 1870.“
Bei der Rückkehr der Spaziergänger fragt die Fürstin: „Haben Sie sich nicht vor dem Regen gefürchtet?“ „Nein,“ antwortete der Fürst, „er hat sich vor uns gefürchtet.“ Der Fürst bedauert freundlich die Sekretäre Crispis, die während der Spazierfahrt arbeiten mußten.
Man erwähnt das Wort eines Ordonnanzoffiziers Viktor Emanuels an den Kaiser Napoleon III. während des Krieges 1859. „Sie müssen von Eisen sein, mein Herr,“ sagte der Kaiser der Franzosen zu ihm, überrascht von seiner Ausdauer bei einem sehr langen Ritt.
„Sire,“ antwortete dieser, „man muß wohl von Eisen sein, wenn man die Ehre hat, einem Souverän von Stahl zu dienen.“
Es wird von Arbeit, von Arbeitsfähigkeit und von Ausdauer bei der Arbeit gesprochen.
Der Minister sagt: „Durchlaucht sind einer der größten Arbeiter, die man kennt.“
Der Fürst antwortet: „Ja... es gab eine Zeit, wo ich zwölf, vierzehn, sechzehn Stunden im Tag arbeitete. Ich habe es bis zu achtzehn Stunden gebracht. Aber das sind Anleihen von Kraft mit Wucherzinsen auf das Alter. Jetzt arbeite ich nur drei bis vier Stunden. Schweninger verbietet mir, länger zu arbeiten.“
„Stehen Eure Durchlaucht früh auf?“
„Gewöhnlich gegen sieben Uhr. Aber, da ich an Schlaflosigkeit leide, kommt es wohl vor, daß ich nach einer schlecht verbrachten Nacht des Morgens noh ruhe und schlummere. Dann stehe ich gegen acht oder neun Uhr auf oder sogar noch später.“
Der Fürst erklärt uns von neuem, daß, trotz seines Aufenthaltes in Friedrichsruh der Lauf der Geschäfte, weit davon entfernt, sich zu verlangsamen, eher beschleunigt, der Dienst erleichtert und nicht geschädigt wird.
„Wie ich Ihnen sagte, schickt man mir jeden Tag pünktlich die Berichte, die zu unterzeichnenden Papiere und so weiter. Dann habe ich hier noch einen anderen Vorteil, und nicht den geringsten: ich bin den Störungen nicht ausgesetzt, welche das Leben in der Hauptstadt notwendigerweise auferlegt. In Berlin kann man als Kanzler nicht umhin, bei gewissen Anlässen bei Hofe zu erscheinen, Besuche zu empfangen, Leute bei sich zu sehen und so weiter. Hier genieße ich meine ganze Freiheit und die vollkommenste Ruhe.“ ...
Um sechs Uhr wird gemeldet, daß das Diner serviert sei.
Der Minister hat der Fürstin den Arm geboten. Man macht einige Komplimente, um nach ihnen einzutreten. Der Fürst interveniert: „Circulez, messieur, circulez,‘ sagen in Paris die Polizisten.“ Graf de Launay geht voran, und der Fürst faßt familiär einen von uns unterm Arm.
Der Tisch ist heute abend mit großem Luxus von Glas, Porzellan und Silber gedeckt...
Die Fürstin sagt: „Wir hatten die Absicht, Ihnen ein italienisches Gericht bereiten zu lassen. Aber ist das hier wirklich Risotto? Ich bezweifle es.“
Die Tischgenossen sind zu zahlreich, um eine allgemeine Unterhaltung aufkommen zu lassen, was uns um mehr als eine der geistreichen Bemerkungen des Fürsten bringt. Privatunterhaltungen knüpfen sich an und mischen und kreuzen sich manchmal.
Am einen Ende der Tafel unterhält man sich von deutscher Literatur und von Lieblingsschriftstellern: Goethe, Schiller und Lessing werden der Reihe nach erwähnt. Einer von uns erklärt sich für einen großen Bewunderer Jean Pauls und rühmt die Originalität dieses Schriftstellers. Die Herren Rottenburg und Schweninger scheinen seine Bewunderung nicht zu teilen.
„Man liest ihn heute in Deutschland sehr wenig mehr,“ bemerkt der Fürst vom andern Ende der Tafel. Man wundert sich sogar, daß ein Italiener mit solcher Sachkenntnis einen Schriftsteller würdige und beurteile, den die meisten Deutschen kaum mehr als dem Namen nach kennen.
Man spricht vom französischen Charakter. Der Minister erinnert an das, was Julius Cäsar vom Charakter der Gallier gesagt. Der französische Charakter ist derselbe, trotz allem, was in das alte Gallien von lateinischem Blut im Süden, von germanischem Blut im Norden eingedrungen ist. Man tauscht einige Ideen darüber aus.
Infolge ich weiß nicht welcher Gedankenverbindung hört man den Fürsten sagen: „Meine Herren, es juckt mich mächtig, vor Ihnen viel Böses über Boulanger zu sagen...“ Das übrige ist nicht zu verstehen, aber die Unterhaltung hat Sich dem zugewandt, der der Mann des Tages in Frankreich ist.
Das Gespräch geht dann auf Napoleon III. über. Der Fürst lernte den Kaiser im April 1857 gelegentlich der Pariser Konferenzen über die Regelung der Neuchâteler Frage kennen. Bismarck war damals noch Vertreter Preußens beim Frankfurter Bundestag. Er sah ihn wieder im September desselben Jahres in Baden-Baden, als sich Napoleon dort vor seiner Zusammenkunft mit dem Kaiser von Rußland in Stuttgart aufhielt. Welche Pläne oder welche Träume mochten damals im Geiste des Franzosenkaisers spuken? Napoleon III. hatte zu jener Zeit deutschfreundliche, sogar preußenfreundliche Bestrebungen: in den Tuilerien wünschte man dem Vaterlande des großen Friedrich und Blüchers das Beste. Kaiserin Eugenie schrieb wenige Monate vorher, nach einem Besuch des Prinzen Friedrich in Paris, wobei dieser von General von Moltke, damals seinem Adjutanten, begleitet war: „Diese Deutschen sind eine gewaltige Rasse. Louis behauptet, sie seien die Rasse der Zukunft! ...“
Im November 1855 beauftragte Napoleon den Marquis Pepoli, der sich nach Berlin begab, dem König Friedrich Wilhelm IV. vorzustellen, wie vorteilhaft ein Bruch zwischen Preußen und Oesterreich für die erste der beiden Mächte wäre. In Deutschland stellte, nach dem künftigen Gefangenen von Wilhelmshöhe, Oesterreich die Vergangenheit, Preußen die Zukunft dar. Indem es mit Oesterreich verknüpft blieb, verdammte sich Preußen zur Unbeweglichkeit, was eines zu Hohem berufenen Staates unwürdig war. Napoleon trachtete also danach, Oesterreich zu isolieren, um es dann zu demütigen, eine Politik, die mit seinen Plänen bezüglich Italiens zusammenhing. Bei dieser Sinnesrichtung hätten der Kaiser der Franzosen und Bismarck sympathisieren können, wenigstens bezüglich einiger Fragen. In der dänischen Frage zum Beispiel fand Bismarck beim Kaiser bestimmtere Ideen als beim Grafen Waleski. Er wurde um diese Zeit französischer Tendenzen verdächtigt. Im Jahre 1856 schreibt er, in Vorausficht eines innigeren Bundes zwischen Frankreich und Rußland, welchen General von Gerlach befürchtete: „Ich fürchte ein solches Bündnis nur unter der Voraussetzung der Unmöglichkeit für uns, mit beiden Füßen in dasselbe einzutreten...“
Im Jahre 1859, als er von Frankfurt abberufen wurde, verbreitete sich das Gerücht, Bismarck habe, zu einem Abschiedessen bei Herrn Bethmann eingeladen, einen Trinkspruch auf das Bündnis zwischen Preußen und Frankreich ausgebracht. Der „Kladderadatsch“ machte aus diesem Gerücht den Gegenstand eines Zwiegesprächs in Berliner Mundart zwischen seinen zwei unsterblichen Typen Müller und Schulze. Aus diesem Anlaß schrieb Bismarck aus Petersburg, wohin er eben versetzt worden war, an den Redakteur des Blattes, Herrn Ernst Dohm, einen Brief, um die Sache zu berichtigen und höflich zu dementieren. In Wirklichkeit „predigte er nicht a priori ein preußisch-französisches Bündnis“, aber er wünschte, die Beziehungen Preußens zu Frankreich sollten derartige sein, daß die Möglichkeit eines Bündnisses zwischen den beiden Staaten nicht aus den diplomatischen Berechnungen ausgeschlossen wäre.
Der Fürst sah den Kaiser der Franzosen wieder im Jahre 1862. Während seiner ungefähr zweimonatigen Botschafterzeit in Paris hatte er damals mehrere Unterredungen mit ihm. Man glaubte ihn immer für die kaiserliche Politik eingenommen. Es war dies noch die Zeit, da man die tiefen Ideen Napoleons III. pries, seine Worte kommentierte und sogar sein Stillschweigen bewunderte. Die deutschen Witzblätter stellten den künftigen Kanzler vor Napoleon dar in der Haltung eines Schülers vor seinem Lehrer. Aber damals schon stand Bismarcks Urteil über ihn fest: im vertraulichen Gespräch bezeichnete er ihn schon als „eine große verkannte Unfähigkeit“.
Er sah den Kaiser im Jahre 1864 zu Biarritz wieder. Es war bei dieser Gelegenheit, als Napoleon, mit ihm am Strande spazieren gehend, auf den Arm Mérimées gestützt, zu diesem ganz leise sagte: „Er ist ein Narr!“ Im Jahre 1867, bei der Weltausstellung war Bismarck, inzwischen Premierminister geworden, mit seinem König Gast in den Tuilerien. Zum letztenmal sah er den Kaiser drei Jahre später, am Tage nach Sedan, auf der Landstraße von Donchéry!
Der Fürst hatte also zu wiederholten Malen Gelegenheit, Charakter und Geist des rätselhaften Herrschers zu studieren, über welchen das Urteil der Geschichte so verschieden hätte ausfallen können, je nach dem Augenblick, in dem ihn der Tod überraschte. Nah Boulogne hätte man ihn für einen Abenteurer gehalten, nah dem Kongreß von Paris oder nach dem italienischen Kriege hätte man ihn als einen der größten Herrscher Frankreichs gepriesen; nach 1870/71 beklagte man ihn als einen der unglücklichsten oder verurteilte ihn als einen der schuldigsten.
„Napoleon III.,“ sagt der Fürst, „war kein schlechter Mensch: er wollte das Gute.“
Crispi bemerkt, daß er keinen festen Willen gehabt, daß seine Politik zugleich „überlegt und chimärisch, verwickelt und naiv war“; indem er für das Gute zu arbeiten glaubte, knebelte er die Freiheit in Frankreich und hielt Europa zwanzig Jahre lang unter der Drohung unbestimmter und schlecht definierter Absichten; indem er es erheben wollte, führte er sein Land in Katastrophen und zum Zusammenbruch.
„Er war unwissend,“ fährt der Fürst fort, „ich habe dies nicht ohne Ueberraschung gemerkt, denn er war in einem deutschen Lyzeum erzogen worden, und die Studien in Deutschland waren zu seiner Zeit schon gut geleitet und gründlich. Er kannte die Geschichte schlecht, mit Ausnahme der Geschichte des ersten Kaiserreiches, und auch diese nur nach Seiner Art, das heißt, vom Gesichtspunkt der Verherrlichung des ersten Napoleon und der Vorbereitung einer Wiederherstellung des Kaiserreiches... Er war in der Geographie und Statistik Schlecht bewandert, es fehlten ihm die elementarsten Kenntnisse.“
Wie einer von uns bemerkt, stimmt das Urteil, welches Seine Durchlaucht über Napoleon II. fällt, mit demjenigen überein, welches der Prinzgemahl von England aussprach. Es wird daran erinnert, daß beim Beginn des orientalischen Krieges Napoleon, der Operationen in der Ostsee wünschte, nicht wußte, daß Kronstadt auf einer Insel liege, und den Plan hatte, Reiterei dorthin zu schicken.
Ich habe noch folgendes Urteil des Fürsten über Napoleon III. mir gemerkt: „Man hat seinem Verstand zu viel und seinem Herzen nicht genug Ehre erwiesen.“ Man spricht lange vom zweiten Empire.
Der politische Niedergang, des Kaiserreichs begann mit dem italienischen Kriege, aber man nahm dies erst später wahr. Höhepunkt dieser historischen Periode ist der Pariser Kongreß.
Der Fürst spricht von der traurigen Lage, in der sich damals Preußen befand.
„Preußen hatte damals sehr niedrigen Kurs.“
Nicht nur hatte es im Jahre 1850 die Demütigung von Olmütz erduldet, nicht nur war seine Rolle in Deutschland gleich Null, da sich Oesterreich und die anderen Staaten gegen es verschworen hatten, sondern es hatte auch in den folgenden Jahren Mißtrauen bei den anderen Mächten erweckt und war, alles in allem, aus der orientalischen Krisis mit vermindertem Ansehen hervorgegangen . . . Oesterreich hatte Preußens Zulassung zu den Konferenzen in Paris vorgeschlagen, aber Rußland machte keine ernstlichen Anstrengungen in diesem Sinn, und England widersetzte sich. Es gab einen Augenblick, Anfang Februar 1856, da man die Bemühungen, Preußens Teilnahme an den Unterhandlungen herbeizuführen, als endgültig gescheitert betrachtete. Baron von Manteuffel, der in seiner Eigenschaft als Minister der auswärtigen Angelegenheiten Preußen dort zu vertreten hatte, mußte Demütigungen einstecken. „Man ließ ihn im Vorzimmer warten, während die Bevollmächtigten der anderen Mächte ihre Beratungen schon begonnen hatten.“
Nur als der Kaiser der Franzosen darauf bestand, wurde der preußische Abgesandte zu den Sitzungen zugelassen. „An Stelle Manteuffels,“ sagt der Fürst, „hätte ich mir das nicht gefallen lassen, sondern mich zurückgezogen, was auch besser gewesen wäre. Hätten wir den Vertrag nicht unterzeichnet, so wären wir nachher freier gewesen.“
Schon zur Zeit des Kongresses schrieb Bismarck an den Grafen von Hatzfeldt, den preußischen Botschafter in Paris:
„Es ist kein Unglück für den deutschen Bund oder für uns, an den Konferenzen nicht teilzunehmen; die Folge davon wird einfach die sein, daß die in den Unterhandlungen festgestellten Bestimmungen, die für Dritte nur ein untergeordnetes Interesse haben können, weder von Preußen noch vom Bunde garantiert werden.“
Währenddem wurde als Braten ein prächtiger Hirschziemer aufgetragen. „Stammt das Tier aus Ihrem Wildbestand, Durchlaucht?“ „Nein,“ sagt der Fürst, „ich schieße mein Wild nicht gern.“
Das Gespräch kommt auf die Küche. Warum auch nicht? Wenn man auch nicht so weit geht wie Doktor Johnson, der sagte, das Diner sei von allen Verrichtungen des Tages die wichtigste, so hat die Küche doch jedenfalls ihre Wichtigkeit im Leben, da von ihr die Gesundheit großenteils abhängt.
„Die französische Küche ist im allgemeinen ausgezeichnet,“ meint der Fürst. „Aber die französischen Köche verstehen es nicht, die großen Stücke, besonders das große Wildbret, herzurichten. Dazu bedarf es einer besonderen Kunst, die sie nicht besitzen. Uebrigens darf man, wenn man Wildbret gut genießen will, nicht ungeduldig sein, und die Franzosen sind es. Man muß zu warten verstehen; das frische Wildbret hat nie seinen ganzen Wohlgeschmack, es muß gebeizt werden und abliegen. Das Stück, das Sie kosten, hat vierzehn Tage gelegen; es wird zart und wohlschmeckend sein. Die französischen Köche glauben, es genüge, das Fleisch zu klopfen; damit macht man es mürbe, erhöht aber seine Güte nicht.“ Nach einer Pause fügt er hinzu: „Das ist vielleicht eine Sache des nationalen Charakters: die Franzosen klopfen gern...!“
Man kann es nicht oft genug wiederholen: der Fürst ist ein unvergleichlicher Plauderer. Liegt die Pointe nicht in den Worten, dann im Ton. Diesen muß man hören und gehört haben. Was er sagt, ist voll Schattierungen, Farben, Anspielungen, Nebenbedeutungen, Feinheiten, die man nicht wiederzugeben vermag. Die Stimme, die Gebärde, die wohlberechneten Pausen, alles wirkt mit, um dem Gedanken Nachdruck zu geben. Bald schlägt er einen heiteren Ton an, bald wird er ernst oder tut wenigstens so.
Der Fürst liebt es, Doktor Schweninger „aufzuziehen“. „In den Aerzten steckt immer etwas vom Priester. So tun sie gerne, was sie den anderen zu tun verbieten.“
Zur süßen Speise wird Maraschino gegeben. „Ein italienischer Likör, nicht wahr?“, fragt der Fürst. „Woraus macht man ihn?“ Wir belehren ihn, daß der Maraschino aus einer Gattung wilder Kirschen gemacht wird, die namentlich in Dalmatien wächst, und in der dortigen Sprache Marasca heißt.
Während man mit dem Grafen Herbert, der unser Land sehr gut kennt, von Italien spricht, lenkt das Lachen der Tischnachbarn die Aufmerksamkeit wieder nach dem Fürsten bin, der den Minister zu seiner Rechten und den Grafen de Launay zu seiner Linken hat. Seine Durchlaucht erzählt soeben die Geschichte eines seiner alten Kollegen im preußischen Kabinett, der zu gleicher Zeit die Oberaussicht über die Waldungen und über die königlichen Meiereien hatte. „Die Verwaltung der Waldungen war ewig im Prozeß mit der der Meiereien. Der Minister unterzeichnete für und gegen jede Verwaltung, abwechslungsweise und alles ohne zu lesen.“
Pause. – „Uebrigens, auch wenn er gelesen hätte, so hätte das nichts geändert.“ – Man steht von Tisch auf und wünscht sich „Mahlzeit“. Während Kaffee und Liköre herumgereicht werden, bietet Graf Herbert Zigarren an. Bei irgendeinem Anlaß beginnt der Fürst: „Ich verdanke dem Zufall meine Gewohnheiten.“ Es wird ein Telegramm gebracht; der Fürst schreibt die Antwort, ohne sich zu erheben, indem er sich nur halb gegen den Tisch dreht. –
Dann spricht er von seinem Aufenthalt in Petersburg. Er kam als preußischer Gesandter Anfang des Monats Mai 1859 dahin. Der Fürst hat Sympathien für Rußland, das ergibt sich deutlich aus der Art, wie er von diesem Lande spricht. Er fühlt den ganzen Wert der Freundschaft Rußlands für Deutschland. Der Hof von Petersburg war 1859, was die Diplomaten einen Familienhof nennen. Der preußische Gesandte war beim Hofe sehr beliebt. Die Kaiserin Mutter, eine Frau von liebenswürdigem Charakter, bezeigte ihm eine fast mütterliche Freundlichkeit. Bismarck unterhielt sich mit ihr, wie wenn er sie seit ihrer Kindheit gekannt hätte. Der Kaiser war sehr herzlich mit ihm. Bismarck besaß außerdem in Petersburg einen Freund in der Person des Fürsten Alexander Michaelowitsch Gortschakow. Es gab keine schwierigen Geschäfte, und alles ging nach Wunsch. Leider wurde Bismarck noch im Sommer des Jahres 1859 krank. Die Krankheit, zugleich rheumatisch, gastrisch und nervös, artete in eine Leberentzündung aus und wurde lebensgefährlich. Endlich genesen, schrieb er an Frau von Arnim, seine Schwester: „Man hat mir den Leib mit unzähligen Schröpfköpfen, groß wie Untertassen, mit Senf- und Zugpflastern von unsinniger Größe bedeckt.“ Schließlich triumphierte er über die Krankheit, dank vor allem – einem edlen Madeirawein, der ihm in mäßigen Dosen gegeben wurde. Aber die Genesung war langwierig. Am Ende des Monats September, als er schon vierzehn Tage in Baden-Baden zugebracht hatte, war der Rekonvaleszent noch schwach, matt und reizbar; sein linkes Bein machte ihm immer noch Schmerzen und schwoll an, wenn er ging. Es war einen Augenblick die Rede davon gewesen, es abzunehmen! Nie hat sich der Fürst ganz von dieser Krankheit erholt. Das Jahr darauf, als Frau von Bismarck und seine Kinder bei ihm eingetroffen waren, kam die Reihe, krank zu werden, an diese: alle litten mehr oder weniger unter dem Klima. Während des Winters 1861/62 gab es keinen einzigen Tag, an dem alle Hausinsassen sich wohl befunden hätten. Der Arzt kam nicht mehr aus dem Hause.
„Ich hatte mich,“ sagt der Fürst, „einem Arzt anvertraut, den mir eine Großfürstin empfohlen hatte. Inzwischen habe ich erfahren, daß er auf der Universität faul und unwissend war. So ist er auch geblieben. Er leitete in Petersburg ein Kinderspital und hatte sich einen gewissen Ruf erworben... Ja, er tötete gewiß seine dreitausend Patienten im Jahr. Er richtete mir das Bein zugrunde – heute noch spüre ich die Folgen seiner Kur. Ich kann nicht lange stehenbleiben, ohne darunter zu leiden. Doch kann ich reiten und will diese Bewegung nicht entbehren, da ich sie immer sehr geliebt habe. Es kommt wohl vor, daß ich drei bis vier Stunden im Sattel bleibe. Ich kann auch ohne Anstrengung gehen, aber wenn ich mir keine Bewegung mache, so kann ich nicht lange die vertikale Haltung beibehalten: ich muß meine Beine ausstrecken.”
Als Philosoph weiß der Fürst die guten Seiten bei unangenehmen Dingen herauszufinden. Seine Schwäche erlaubt ihm nicht, Zeremonien, Empfängen und so weiter beizuwohnen, bei welchen man nach der Etikette stehen muß.
„Ihre Majestäten der König und die Königin,“ sagt der Fürst, „haben mich auch ein für allemal der Pflicht entbunden, bei Festen, Bällen und so weiter, wo sie Cercle halten, zu erscheinen. Der Oberhofmarschall versäumt es trotzdem nie, mir regelmäßig seine Einladungen zu schicken, mit der üblichen Formel: ‚Auf Befehl Ihrer Majestäten des Königs und der Königin.” Ich meinerseits habe gedruckte Formulare, um auf die höflichste Art von der Welt die Einladungen, die ich erhalte, abzulehnen. Ich habe nichts zu tun, als den leeren Raum auszufüllen und das Datum hinzuzufügen. Ich bereichere auf diese Weise die Mappen des Oberhofmarschalls.“
Der Fürst spricht von den Schwierigkeiten seiner Anfangszeit als Minister. „Früher,“ sagt er, „mußte ich im preußischen Kabinett, obgleich Präsident des Ministerrats, peinliche und schwierige Kämpfe bestehen. Bei uns in Preußen ist jeder Minister Herr in seinem Departement. Das Kabinett gleicht einem Bundesstaat, dessen Mitglieder durch ein sehr lockeres Band verbunden sind. Wir hielten bis zu vier oder fünf Sitzungen in der Woche, und manchmal erforderten die Diskussionen zwei Sitzungen im Tage. Nun hatte ich nur eine Stimme und konnte im offenen Kampfe nicht Herr der Situation werden. So blieb mir nichts anderes übrig, als die Meinung des Königs einzuholen, eine Meinung, welche bei uns Befehl ist, demgegenüber jeder Widerstand aufhört. Ich muß sagen, daß trotz des Druckes, den man oft und vielmals auf Seine Majestät auszuüben suchte, der König mir niemals seine Zustimmung versagt hat. Vor der Stimme Seiner Majestät beugt man ich. Aber der Kampf begann dann auf einem andern Gebiete. Heute brauche ich das nicht mehr. Man weiß, daß ich die Stimme des Königs bekäme, wenn ich sie einholen würde. Man gibt mir also a priori recht, und wir halten fast keine Kabinettssitzungen mehr ab.“
„Aus ähnlichem Grund,“ wird bemerkt „hielt Napoleon I. niemals einen Kriegsrat ab.“ – Mit einigem Behagen verweilt der Fürst im Gespräch bei den Kriegen von 1866 und 1870/71. Vom siebziger Krieg sagt er: „Diesen habe ich nicht gewollt. Wir waren darauf vorbereitet, weil unser Heer vortrefflich war und wir den Krieg als unvermeidlich voraus sahen. Aber ich habe nicht zum Krieg herausgefordert. Wir hatten keinen Grund, ihn zum Ausbruch zu bringen.“…
„Was den von 1866 betrifft,“ fährt Seine Durchlaucht fort, „so war dieser Krieg notwendig: Die Stellung Preußens zum Deutschen Bunde war so fehlerhaft, daß es darunter zu leiden hatte. Aber ich hatte Mühe, den Krieg vorzubereiten, den König, den Hof und die konservative Partei dazu zu bestimmen. Später, nah Sadowa, hatte ich mit der Militärpartei zu kämpfen, welche den Sieg mißbrauchen wollte. Ich wollte Oesterreich nicht demütigen: ich wußte, daß wir es noch brauchen könnten; ich rechnete darauf, daß es unser Verbündeter werden würde. Die Militärpartei würde, wenn ich ihrem Verlangen nachgegeben hätte, das Bündnis unmöglich gemacht haben, das ich später zwischen den Zentralmächten herzustellen gedachte.
Man hat gesagt, der Krieg von 1866 sei ein Bruderkrieg gewesen. Das ist wahr. und wenn es ein Mittel gegeben hätte, ihn zu vermeiden, so würde ich dazu gegriffen haben. Aber es gab keines; ich habe mich davon überzeugen müssen. Der Krieg allein konnte in Deutschland das Werk der Verträge von 1815 zerstören, die deutsche Frage lösen, den gordischen Knoten zerhauen, in den wir seit Jahrhunderten verwickelt waren. Der Krieg war notwendig.“
Er spielt auf die überwundenen Schwierigkeiten, sowie auf die Gefahr an, der er sich aussetzte, denn im Fall eines Mißerfolges kompromittierte er für immer seinen Namen und den schon erworbenen Ruhm. Wenn der Krieg von 1866 für Preußen unglücklich ausgefallen wäre, so ist es klar, daß Bismarck der Sündenbock für alle Fehler gewesen wäre, der Verbrecher, den man angeschuldigt hätte, durch seine Leichtfertigkeit das Land dem Untergange zugeführt zu haben; alle Ovationen, die er beim Triumphzuge der Truppen empfing, würden, wie er sagte, „wenn die Dinge einen anderen Verlauf genommen hätten, sich ins Gegenteil von Huldigungen verwandelt haben“. Auf dem Schlachtfeld von Sadowa sagte ein alter General zu ihm: „He, meine Grenadiere haben Ihnen nicht schlecht geholfen! Man wird Ihnen Triumphbögen errichten! Aber wären wir geschlagen worden, so hätten unsere alten Weiber Ihnen bei der Rückkehr ihre Besen auf dem Rücken zerhauen.“
Man spricht wieder vom französischen Kriege. „Die Franzosen hassen mich, weil sie geschlagen worden sind. Sie haben unrecht, es war ihre Schuld. Diesen Krieg habe ich weder gewollt noch gesucht. Sie haben uns dazu herausgefordert und uns zum äußersten getrieben. Sie hatten bereits eine diplomatische Genugtuung durch den Verzicht des Prinzen von Hohenzollern. Das hat ihnen aber nicht genügt. Sie hätten Preußen gerne gedemütigt. Wahrhaftig, wir wollten den Krieg nicht, aber wir waren darauf vorbereitet, ihn zu führen. Seit Sadowa grollten sie uns. So brachten sie es dahin, daß die Gefühle ganz Deutschlands, vom Norden bis zum Süden, vom Osten bis zum Westen, sich gegen sie empörten. Sie glaubten, der Süden werde mit ihnen sein, wie er im Jahre 1866 mit Oesterreich gewesen war. Es war reine Verblendung.“
Nach beiden Feldzügen von 1866 und 1870/71 wurde der Fürst ernstlich krank. „Dafür,“ sagt er, „habe ich mich niemals besser befunden als während des französischen Krieges. Es kam vor, daß ich unter freiem Himmel schlafen mußte, in einer Ackerfurche ausgestreckt, mit einem Ordonnanzmantel zugedeckt, und daß ich nichts zu essen hatte als Schwarzbrot und ein Stück Speck, von dem das Fett mir in die Hand floß. Trotzdem befand ich mich wunderbar. Ich begoß Brot und Käse mit einem halben großen Glase Kognak und schlief wie ein Sack. Die Müdigkeit kam erst unter den Mauern von Paris über mich, bei den Unterhandlungen.“
Das Gespräch nimmt eine neue Richtung. Einer von uns, den der Minister zu loben die Güte hat, sucht die Unterhaltung von sich abzulenken und sagt scherzend zu Crispi: „Eure Exzellenz machen mich erröten…. ist dies einem Diplomaten erlaubt, Durchlaucht?“ Der Fürst tut einen langen Zug aus seiner Pfeife und antwortet: „Ein Diplomat muß die Fähigkeit zu erröten bewahren!“
Wir erzählen dem Fürsten die Unterhaltung, die wir im Waggon mit dem Minister über die „Lüge in der Politik“ gehabt haben. „Herr Crispi,“ sagen wir, „läßt die Lüge durchaus nicht und in keinem Falle zu.“
Der Minister nimmt das Wort, um zu sagen, daß nach seiner Ansicht die Lüge, auch ganz abgesehen von der abstrakten Moral, an sich meistens eine Ungeschicklichkeit und Plumpheit sei. Man wartet darauf, was der Fürst sagen werde; er scheint nachzudenken. Graf Herbert mischt sich ein.
„Entschuldigen Sie, Exzellenz, in gewissen Fällen wäre man doch sehr in Verlegenheit. Sie haben manchmal mit Leuten zu tun, die Sie mit einer Unverfrorenheit, mit einer Indiskretion fragen, die Sie an die Mauer drücken. Was soll man da tun?“
„Der Frage ausweichen!“
„Das heißt seine Verlegenheit verraten.“
„Schweigen!“
„Das heißt manchmal zugestehen! ...“
Der Fürst dreht sich halb herum: „Ich lüge nicht gerne; die Lüge ist mir verhaßt, aber ich gestehe, daß ich in einigen seltenen Fällen in meinem politischen Leben dazu greifen mußte. Ich sah mich dazu gezwungen, und war stets gegen diejenigen erzürnt, die mich zu fügen zwangen. Das ärgert mich!“
Man bringt Erfrischungen: Gefrorenes, Bier. Die Unterhaltung wird unterbrochen …
Man hört den Fürsten Herrn von Pourtalès fragen: „In welchem Grade find Sie mit der Gräfin von Pourtalès verwandt, die im Jahre...“ Der Rest des Satzes sowie die Antwort wurden durch andere Stimmen übertönt. Der Fürst sagt dann wieder: „Eine sehr hübsche und sehr liebenswürdige Frau.“
Minister Crispi möchte sich zurückziehen.
„Nein,“ sagt der Fürst, „ziehen Sie sich noch nicht zurück, oder wenn Sie es tun, bleiben Sie wenigstens noch den morgigen Tag bei uns.“
Der Minister beharrt aber: der Fürst möge ihm zuliebe nichts an seinen Gewohnheiten ändern.
Was die Verlängerung seines Aufenthaltes betrifft, so ist sie unmöglich; er muß sogar so rasch als es geht nach Italien zurückkehren.
„Ich möchte Sie zurückhalten,“ sagt der Fürst, „aber ich begreife Ihre Gründe.“
Der Fürst ist bei seiner vierten Pfeife, und aus Folgsamkeit gegen die Vorschriften des Arztes muß er es dabei bewenden lassen.
Jemand fragt, ob Seine Durchlaucht keine Zigarren mehr rauche. „Nein, Schweninger verbietet mir‘s. Früher rauchte ich viel. Im Jahre 1857, als ich von Paris zurückkam, zündete ich meine Zigarre um fünf Uhr morgens an und ließ sie nicht ausgehen bis zehn Uhr abends, so daß eine Zigarre der anderen ohne Unterbrechung folgte. Auf solche Weise regt man sein Nervensystem auf, das sind Anleihen, die man auf die Gesundheit der Zukunft macht; das ist, wie wenn man nach sechzehnstündiger Arbeit eine Flasche Champagner trinkt, um sich zum Weiterarbeiten zu animieren.
„Die Zigarre,“ fährt der Fürst fort, „war für mich eine Notwendigkeit geworden ... Ich war sJo sehr daran gewöhnt, daß sie für mich zum Beispiel beim Reiten ein Element des Gleichgewichts wurde. Ich erinnere mich, daß bei einer Jagdpartie mein Pferd stürzte, ich war von den anderen Jägern entfernt, man fand mich mehrere Stunden nachher bewußtlos, aber die ausgegangene Zigarre noch im Munde zwischen den Zähnen.“
Es wird spät; nach einigen Worten über die Route der Rückkehr gaben der Minister und Graf de Launay das Zeichen, sich zurückzuziehen. Der Fürst und die Fürstin sagen Crispi noch, wieviel Vergnügen ihnen sein Besuch gemacht hat.
„Und wie wohl hat er mir moralisch und physisch getan, denn ich fühle mich entschieden besser, und dies verdanke ich Ihnen.“
Fürst und Fürstin sowie der Minister ziehen sich zurück.
Am nächsten Tag vereinigt man sich im Salon.
Fürst und Fürstin lassen sich‘s durchaus nicht nehmen, ihren Gast bis zur Bahn zu begleiten.
Alles, was man nur zu einer ersten Mahlzeit wünschen mag, ist auf dem Tische. Man frühstückt ziemlich schweigsam. Der Fürst wechselt einige Worte mit seinen Nachbarn, dem Minister und dem Botschafter; aber ein Schleier von Trauer liegt auf allen.
Der Minister dankt dem Fürsten für seine herzliche Gastfreundschaft, der Fürst seinerseits für den angenehmen Besuch — in warmen und gerührten Worten.
Man geht zu Fuß nach dem Bahnhofe. Das Wetter ist feucht und nebelig. Man bleibt beim Waggon des Ministers stehen.
Der Fürst und Crispi wechseln noch einige fette Worte, die einen Teil ihrer Unterredungen zusammenfassen. „Ich werde,“ antwortete der Fürst auf eine Frage, „unterschreiben, was Sie unterschreiben.“ Auf eine andere Frage: „Wir werden für Sie sein, was Sie für England sind.“ Auf eine dritte Frage: „Die Freunde unserer Feinde sind unsere Feinde; die Freunde unserer Freunde sind unsere Freunde.“
Die am morgen angekommenen Blätter bringen Telegramme, welchen zufolge die ganze französische Presse glaubt, der Minister sei nah Friedrichsruh gekommen, um die vatikanische Frage zur Lösung zu bringen. „Die vatikanische Frage!“ sagt der Fürst lachend. „Vielleicht die einzige Frage, über welche wir kein Wort verloren haben. Sie bleiben sich immer gleich: ils vont chercher midi à quatorze heures (sie suchen immer das Unmögliche).“
Bei einer anderen Frage verschanzt sich der Fürst hinter seinem Souverän. „Ich werde mit dem Kaiser darüber sprechen müssen.“ „In Geschäften,“ antwortete der Minister, „sind doch Sie der Kaiser.“
Ein ferner Pfiff kündigt den Hamburger Zug an. „Wir sind in allem einig,“ sagt noch der Fürst. Und er fügt hinzu, indem er dem Minister die Hand drückt: „Wir können zufrieden sein: wir haben Europa einen Dienst erwiesen.“
Man sagt sich Lebewohl. Jeder drückt dem Fürsten die Hand und küßt sie der Fürstin.
„Auf Wiedersehen im nächsten Jahr!“ „A rivederci!“
Der Minister lädt den Fürsten ein, nach Italien zu kommen. „Ich könnte Ihnen in meiner Villa zu Neapel keine so großartige Gastfreundschaft bieten wie die Ihre, die wir soeben in Friedrichsruh genossen, aber sie wird nicht minder herzlich sein. Kommen Sie uns besuchen.“ „Wer weiß!“ meint der Fürst.
Der Zug kommt an, mit Passagieren überfüllt. Viele steigen aus, da sie nur bis Friedrichsruh gefahren waren in der Hoffnung, Crispi und den Fürsten zu sehen.
Der Minister, der allein noch nicht eingestiegen war, verabschiedet sich von der Fürstin, drückt die Hand des Fürsten und steigt in den Waggon. Im Augenblick der Abfahrt stehen der Minister und sein Gefolge mit entblößtem Haupte an den Fenstern. „Auf Wiedersehen!“ sagt noch der Fürst, indem er noch ein letztes Mal Crispis Hand drückt. Er „Im nächsten Jahr! In Friedrichsruh“